Das Gesetz der abnehmenden Responsivität: Warum wir eine Amtszeitbegrenzung brauchenEin Kommentar
Ähnlich wie am Ende der Ära Kohl wird nun auch zum Ende der Ära Merkel akademisch wie politisch über eine Amtszeitbegrenzung der Kanzlerschaft nachgedacht – obwohl die deutsche Bevölkerung doch eine solche Neigung zur Kontinuität hegt. Aber gerade deswegen forderte zum Beispiel Ende März der Berliner Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel genau das: eine Amtszeitbegrenzung, damit »keine Ersatzkönige und -königinnen regieren«[1]. Grüne und Union machten sich diese Forderung zu eigen,[2] während andere Politikwissenschaftler*innen die Gegenposition einnahmen.[3] Vielleicht haben wir Deutschen jedoch auch einfach unseren eigenen hintergründigen Humor nicht verstanden, denn selbst offenkundiger Wandel geht bei uns mit Kontinuität einher: Als Gerhard Schröder 2005 als Kanzler knapp nicht bestätigt wurde, hing dies auch mit einem Überdruss an des Kanzlers »Basta«-Politik zusammen. Die Bevölkerung wünschte sich einen anderen Politikstil, und sie fand und unterstützte ihn zeitweilig bei Angela Merkel. Oder besser gesagt: Sie bekam bei ihr einen anderen politischen Kommunikationsstil. Denn was unterscheidet inhaltlich die Aussage, etwas sei »alternativlos«, von der Aussage »Basta – der Beschluss ist jetzt so gefallen, weil er als der einzig richtige im Kanzleramt erachtet wird«? Wenig, außer dass ironischerweise ausgerechnet das »Basta« von Schröder demokratischer ist, da es – theoretisch – impliziert, dass es eine Diskussion von Alternativen geben kann und auch gegeben hat. »Basta« heißt Schluss mit der Diskussion – es muss entschieden werden, und dies ist nun Kernaufgabe der Exekutive. »Alternativlos« avancierte hingegen gar zum Unwort des Jahres 2010, weil es die politische Debatte gar nicht erst mitdenke. »Alternativlos« suggeriere »sachlich unangemessen, dass es bei einem Entscheidungsprozess von vornherein keine Alternativen und damit auch keine Notwendigkeit der Diskussion und Argumentation gebe«, so das harsche Jury-Urteil.[4]
Die Formulierung der »Alternativlosigkeit« ist entsprechend eine demokratietheoretisch problematische Verengung des »Bastas«. Zwar gestehen selbst ihre Gegner*innen der Kanzlerin zu, dass viele ihrer Entscheidungen möglicherweise jeweils die beste Alternative im Sinne einer pragmatischen Lösung wie im Falle der Eurokrise gewesen sei – nur gab es eben doch Alternativen. »Die Behauptung von Alternativlosigkeit ist nicht nur riskant, sondern auch irreführend. Demokratische Entscheidungen können keine absolute Richtigkeit oder Wahrheit beanspruchen, sie sind fehlbar und komplex«, kommt auch die Politikwissenschaftlerin Astrid Séville zu einem kritischen Urteil bezüglich Merkels Rhetorik der Alternativlosigkeit.[5] Es ist im Kern zwar »nur« eine Rhetorik und spiegelt sicherlich nicht ein anti-pluralistisches Politikverständnis der Kanzlerin wider. Ähnlich wie das »Basta« erscheint aber auch Merkels Diktum der »Alternativlosigkeit« einer technokratischen, outputorientierten Exekutivüberlegung zu entstammen. Wenig erstaunlich indes, dass jeweils diese Art der politischen Kommunikation zum Kristallisationspunkt der oppositionellen Kritik geriet, denn: Etwas Könighaftes kann weder dem Schröderschen »Basta« noch der Merkelschen »Alternativlosigkeit« ganz abgesprochen werden. Formierte sich gegen Schröders »Basta« bezüglich der Arbeitsmarktpolitik die »Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit« (WASG), die später mit der PDS zu der Partei »Die Linke« fusionierte, gründete sich unter Merkel vordergründig anlässlich der Euro-Rettungspolitik, aber im Kern verursacht durch Unzufriedenheit im national-konservativen Lager, die »Wahlalternative 2013«, deren Protagonisten bald daraufhin die AfD ins Leben riefen.[6] Und der eher staatstragende Teil der Coronaproteste jenseits der »Querdenker«-Bewegung opponierte in den vergangenen Monaten weniger gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, sondern vor allem gegen die Art, wie diese kommuniziert wurden. Die vorwiegend von Schauspieler*innen getragene #allesdichtmachen-Kampagne im April 2021 mag die Corona-Maßnahmenpolitik zwar intellektuell nicht durchdrungen haben. Sie stellte aber auf künstlerisch-emotionaler Ebene die Defizite der öffentlichen Debatte und politischen Kommunikation bloß, die als eine Art Fortsetzung der »Alternativlosigkeit« der 2010er Jahre interpretiert wurden. Ob diese Interpretation angemessen ist, sei dahingestellt. Das große rhetorische Vermächtnis der Ära Merkel – das »Wir schaffen das« während der so genannten Flüchtlingskrise 2015 – weist in eine andere Richtung. Denn hier stellte die Kanzlerin ihre Entscheidung nicht als alternativlos dar, sondern als die politische Variante, die sie geschlossenen Grenzen vorzieht.
Aber hier soll es nicht um eine Bilanz der Regierung Merkel gehen, sondern vielmehr um den gesellschaftlichen Ausdruck von Unbehagen angesichts einer wahrgenommenen Machtfülle und damit einhergehenden technokratischen Debattenlosigkeit. Hätte eine Amtszeitbegrenzung den Ursachen dieses Unbehagens entgegenwirken können? Bedenkt man, dass sich die zwei erfolgreichsten Parteineugründungen seit 1990 an den Rändern des Parteiensystems abspielten und nicht nur durch ihre Themen, sondern auch in ihrer Gegnerschaft zur jeweiligen Kanzlerin bzw. zum jeweiligen Kanzler begründet waren, ist dies ein guter Hinweis, dass wir uns nicht nur aus feuilletonistischer Unterhaltung über eine Amtszeitbegrenzung Gedanken machen sollten. Denn sie betrifft die Frage nach der Stabilität unseres politischen Systems. Es geht eben nicht nur um ein gefühltes Unbehagen in Teilen der Bevölkerung. Die Frage ist: Würde unsere parlamentarische Demokratie tatsächlich besser funktionieren im Sinne einer besseren Umsetzung der Wünsche der Wählerschaft und in der Folge einer höheren Demokratiezufriedenheit, wenn wir eine Amtszeitbegrenzung der Kanzlerschaft hätten? Und erzeugen wir ohne sie potenzielle Ersatzkönig*innen, wie Wolfgang Merkel, es formulierte?
Es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass dem so ist. Insbesondere birgt eine Amtszeitbegrenzung das Potenzial einer verbesserten Repräsentationsbeziehung zwischen Regierten und Regierenden und somit in der Wirkung eine erhöhte Demokratiezufriedenheit in der Bevölkerung. Dies gilt vor allem dann, wenn ein politisches System in der Regierungsbildung zeitweilig unflexibel ist, wie ich nachfolgend argumentieren werde.
Warum Amtszeitbegrenzungen der parlamentarischen Demokratie eigentlich wesensfremd sind
Offenkundig liegt in der stark zunehmenden Personalisierung der Politik ein Element, das wir in der Grundkonzeption der parlamentarischen Parteiendemokratie nicht bedacht haben.[7] Und tatsächlich ist es gar nicht so leicht, die Frage nach den Vor- und Nachteilen einer Amtszeitbegrenzung befriedigend zu klären. Vielleicht mag man einwerfen: Könnte das nicht einfach jemand einmal modellieren, welche Effekte die Einführung einer Amtszeitbegrenzung hätte – so wie auch zur Erklärung der Corona-Pandemie Modelle erstellt wurden? Selbstverständlich ist das möglich, nur müssen wir uns über die Begrenztheit der langfristigen Aussagekraft solcher Prognosemodelle bewusst sein. Denn wir stehen hier ja vor der Aufgabe, die Wirkung einer Maßnahme – der Amtszeitbegrenzung – abzuschätzen, die es bislang in parlamentarischen Demokratien nicht gibt. Wir müssen nach dem Kontrafaktum fragen, also danach, ob irgendetwas nicht eingetreten wäre oder künftig eintreten würde, wenn es die Amtszeitbegrenzung gäbe.
Zur Annäherung an eine Antwort müssen wir uns zunächst vergegenwärtigen, Warum Amtszeitbegrenzungen der parlamentarischen Demokratie eigentlich wesensfremd sind. Das zentrale Erfordernis einer repräsentativen Demokratie ist es, dass sich die Regierenden in ihren Entscheidungen nach den Wünschen der Regierten richten. In der Politikwissenschaft sprechen wir von »Responsivität«. Der US-amerikanische Demokratieforscher Robert A. Dahl definierte eine Demokratie entsprechend als diejenige Staatsform, in der die Regierenden sich responsiv zu den Wählerwünschen verhalten.[8] Zur Sicherstellung dieser Responsivität bedarf es einer Sanktionsmöglichkeit. Diese garantiert, dass die Regierenden ggf. bestraft oder belohnt werden, wenn sie die Wünsche der Regierten nicht umsetzen. Die Regierenden müssen also zur Verantwortung gezogen werden können. Dies geschieht in Demokratien mittels fairer und freier Wahlen, bei denen die Bevölkerung regelmäßig die Möglichkeit erhält, die Regierung abzuwählen und die vormalige Opposition in die Regierung zu schicken. Dieser Kreislauf aus Responsivität und Verantwortlichkeit sichert u. a. die demokratische Qualität eines politischen Systems. Nun ist dieser Kreislauf dynamisch zu denken; Responsivität ist nicht statisch. Die Welt verändert sich während einer Legislaturperiode. Die Regierung erhält demnach ein allgemeines Mandat, das politische Gemeinwesen im Sinne der Wahlbevölkerung für eine bestimmte Amtszeit nicht nur zu erhalten, sondern auch weiterzuentwickeln und den äußeren Umständen anzupassen. Der Kreislauf aus Responsivität und Verantwortlichkeit soll über den Wählerstimmenwettbewerb somit auch Innovation gewährleisten.[9] Im Grunde sammelt die Opposition zum jeweiligen Wahlzeitpunkt bei ausbleibender oder mangelnder Innovation dialektisch die Unzufriedenen ein, bis sie die neue Mehrheit stellt. Demokratien nutzen somit inhaltliche Konflikte im politischen System zur eigenen Stabilisierung und Weiterentwicklung, während Autokratien solche Konflikte unterdrücken. Eine Amtszeitbegrenzung würde diese Dynamik rüde unterbrechen. Ohne die Möglichkeit einer Wiederwahl fehlt der Sanktionsmechanismus, der die Responsivität sicherstellt. So gesehen lag die größte historische Leistung von Helmut Kohl vielleicht gar nicht in der Deutschen Einheit, sondern in der Akzeptanz der Niederlage im Jahre 1998, die Deutschland erstmals einen »vollständigen« Regierungswechsel von schwarz-gelb zu rot-grün brachte.[10] Und trotzdem gab es auch zu Kohls Zeiten schon Überlegungen, ob eine Amtszeitbegrenzung sinnvoll gewesen und ein Teil des so genannten »Reformstaus« der 1990er Jahre nicht aufgetreten wäre, hätte es schon vor 1998 wenigstens einen Wechsel im Kanzleramt gegeben.
Warum es in präsidentiellen Systemen trotzdem Amtszeitbegrenzungen gibt
Amtszeitbegrenzungen werden in Deutschland meist mit Blick auf gänzlich andere politische Systeme wie das in den USA gefordert, obwohl das dortige präsidentielle System grundlegend anders funktioniert als eine parlamentarische Demokratie. Während wir in Deutschland wie selbstverständlich von einer Schicksalsgemeinschaft der mehrheitstragenden Fraktionen im Parlament mit der Regierungsspitze ausgehen, ist die US-amerikanische Präsidentschaft nicht auf die politische Unterstützung des Kongresses angewiesen. Er – oder künftig womöglich auch sie – wird direkt von der Bevölkerung gewählt und ggf. bei der nächsten Wahl auch wieder abgewählt. Aus politischen Gründen kann es zwischen diesen beiden Urnengängen keine Abberufung geben. Ein Misstrauensvotum wie in einer parlamentarischen Demokratie ist nicht vorgesehen. Lediglich bei schweren verfassungsrechtlichen Verstößen kann es mit einer Zweidrittelmehrheit in beiden Parlamentskammern zu einer Absetzung des Präsidenten, dem so genannten »Impeachment«, kommen. Während die direkte Legitimation der Präsidentschaft durchaus als ein Vorteil im Sinne eines zusätzlichen Partizipationskanals für die Bevölkerung gesehen werden kann, erwächst hieraus aber auch eine Form der dualen Legitimität, die zu einer kontinuierlichen Konfliktstellung von Legislative und Exekutive führt. Der Politikwissenschaftler Juan Linz sah genau in dieser dualen Legitimität einen permanenten Konfliktherd, der im Kern nicht lösbar sei. Ohne eine den Kompromiss begünstigende politische Kultur würden präsidentielle Systeme daher anfällig sein, zusammenzubrechen.
Die große Machtfülle des US-Präsidenten hat im historischen Prozess und nach Vorbild des ersten Präsidenten George Washington dazu geführt, dass nur eine Wiederwahl erlaubt wurde. Es gibt nicht wenige in der Politikwissenschaft, die daher präsidentielle Systeme als im Kern undemokratisch betrachten, weil sie einer Person strukturell so viel Macht geben, dass sie den Responsivitäts-Verantwortlichkeitsmechanismus außer Kraft setzen. Sie halten präsidentielle Demokratien daher schlicht für »begrenzte Monarchien«[11]. Eine Lösung dieses Dilemmas bietet die Schweizer Verfassung: Als diese 1848 ausgearbeitet wurde, erhielt nicht eine Person, sondern ein Kollektivorgan aus sieben Personen – der Bundesrat – die präsidiale Macht. In diesem Kollektivorgan wechselt zudem jährlich der Vorsitz.[12] In beiden Fällen wird die implizite oder explizite Amtszeitbegrenzung durch die exekutive Machtfülle begründet, die diesen schweren Eingriff in den demokratischen Responsiviätsmechanismus erforderlich mache. Im Falle einer repräsentativen Demokratie verbietet sich jedoch eine einfache Analogie zu einem präsidentiellen System schlicht aufgrund der Unterschiedlichkeit der Systeme. Um das nachvollziehen zu können, müssen wir uns die Kette der Responsivität in einer parlamentarischen Demokratie vertieft anschauen.
Das Gesetz der abnehmenden Responsivität
Die Qualität der demokratischen Repräsentation wird häufig über die inhaltliche Kongruenz der Wahlbevölkerung mit der Regierung ermittelt. Sofern diese stark sei, könne auch von einer hohen Responsivität ausgegangen werden.[13] Nun sind aber mehrere Schritte vonnöten, bis aus den Präferenzen der Wählerschaft eine konkrete Regierungspolitik folgt. Auf jedem dieser Schritte verringert sich zwangsläufig die Kongruenz zwischen Wählerschaft und Regierenden.[14] Im ersten Schritt wird über den Wahlmechanismus die tatsächliche Heterogenität der Bevölkerung in repräsentierte Heterogenität umgewandelt.[15] Neben der mechanischen Verzerrung durch den automatischen Ausschluss von Wählerstimmen durch die Prozenthürde, zeigt sich in den letzten Jahrzehnten ebenso eine Zunahme einer verzerrten Wahlenthaltung sozio-ökonomisch benachteiligter Gruppen, sodass das Parlament eben nicht die vollständige gesellschaftliche Heterogenität abbildet, weder inhaltlich noch symbolisch. Durch das Fernbleiben vor allem sozio-ökonomisch schlechter gestellter Gruppen von den Wahlurnen droht ein Teufelskreis: Diejenigen, die sich ohnehin schon nicht gut in die Gesellschaft integriert fühlen und auch tatsächlich schlechter integriert sind, enthalten sich der Wahl, weshalb ihre Präferenzen nicht in das politische System eingespeist werden.[16] Die politischen Parteien sehen zudem wenig Anreize, um eine Wählergruppe zu werben, die höchstwahrscheinlich ohnehin nicht wählen geht. Unter Umständen verhalten sich die Parteien zwar hochresponsiv – aber nur in Bezug auf die Gruppen, die wirklich wählen. Auf der nächsten Stufe der Delegationskette einer parlamentarischen Demokratie kommt es nun zu einer weiteren Einschränkung: Aus dem schon verzerrt repräsentativen Parlament heraus wird die Regierung gewählt. Mit höherer Wahrscheinlichkeit wird sich diese Regierung auf jene Parteien stützen, deren Wählerschaft besonders zahlreich an der Wahl teilgenommen hat. Der andere Teil der Wählerschaft landet zumindest temporär in der parlamentarischen Opposition. Grundsätzlich geht die empirische Demokratieforschung davon aus, dass mit einer größeren Abdeckung – oder: Inklusion – der Wählerschaft durch die Regierungsparteien auch die Demokratiequalität steigt.[17] Ein ähnlicher Effekt entsteht auch, je mehr Parteien sich in einer Regierungskoalition wiederfinden.[18] Allerdings gibt es hier einen für die Demokratiequalität paradoxen Effekt: Zwar weisen Vielparteienkoalitionen eine vergleichsweise hohe Kongruenz mit den Präferenzen der Gesamtbevölkerung auf, doch zugleich ist es für die Bevölkerung schwieriger, die Verantwortlichkeit für konkrete politische Maßnahmen den einzelnen Regierungsparteien zuzuordnen. Was auf den ersten Blick nach höherer Kongruenz und somit auch höherer Responsivität aussieht, bedeutet im Zeitverlauf zugleich eine Einschränkung des Responsivitäts-Verantwortlichkeitsmechanismus. Die Möglichkeit zum Regierungswechsel oder eine wie auch immer geartete Alternanz der Regierungszusammensetzung[19] bleibt somit zentral, um die demokratische Qualität und auch im Zeitverlauf eine umfassende Berücksichtigung der Präferenzen der Wahlbevölkerung sicherzustellen. Im dritten Delegationsschritt verstärkt sich die Inkongruenz nun noch weiter, weil aus der Regierung heraus die Initiativen für konkrete politische Maßnahmen erfolgen und diese nicht unerheblich vom politischen Spitzenpersonal und im deutschen Fall von der Richtlinienkompetenz der Kanzlerin oder des Kanzlers abhängen. Wie bereits dargestellt, besteht – anders als im präsidentiellen System – im parlamentarischen System eine permanente Sanktionsmöglichkeit gegen die Regierungsspitze aus dem Parlament heraus, nämlich die Abberufung mittels eines Misstrauensvotums. Dies sichert ein Mindestmaß an Responsivität im gesamten politischen Prozess. Allerdings sollte nicht vergessen werden, wie weit wir uns hier in der Delegationskette schon von der Parteibasis und der Wählerschaft als Gesamtheit entfernt haben.
Eines der ältesten Gesetze der Parteienforschung ist der von dem Soziologen Robert Michels bereits 1911 diagnostizierte Umstand, dass die Parlamentsfraktion in einer repräsentativen Demokratie früher oder später das Kraftzentrum einer Partei wird – allein aufgrund ihrer Expertise und der ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen. Michels nannte es das »Gesetz der Oligarchie« – dass wenige aus der Fraktion die Parteigeschicke bestimmen. Die deutsche »Kanzlerdemokratie« (Niclauß) verstärkt und verändert diesen Effekt insofern, als dass die Fraktion ja die Regierungsmehrheit sicherstellen muss.
Eine lange Amtsdauer der Kanzlerin oder des Kanzlers geht in der Regel mit einer Dominanz der Regierungsspitze über die Fraktion einher. Entsprechend wertet die Politikwissenschaft den Austausch der Regierungsspitze durchaus als ein Element der Alternanz, weil mit ihrer Erneuerung eine Veränderung der persönlichen Netzwerke, Themenschwerpunkte und somit der konkreten Regierungspolitik einhergeht – selbst ohne Wechsel der Parteienzusammensetzung der Regierung.[20]
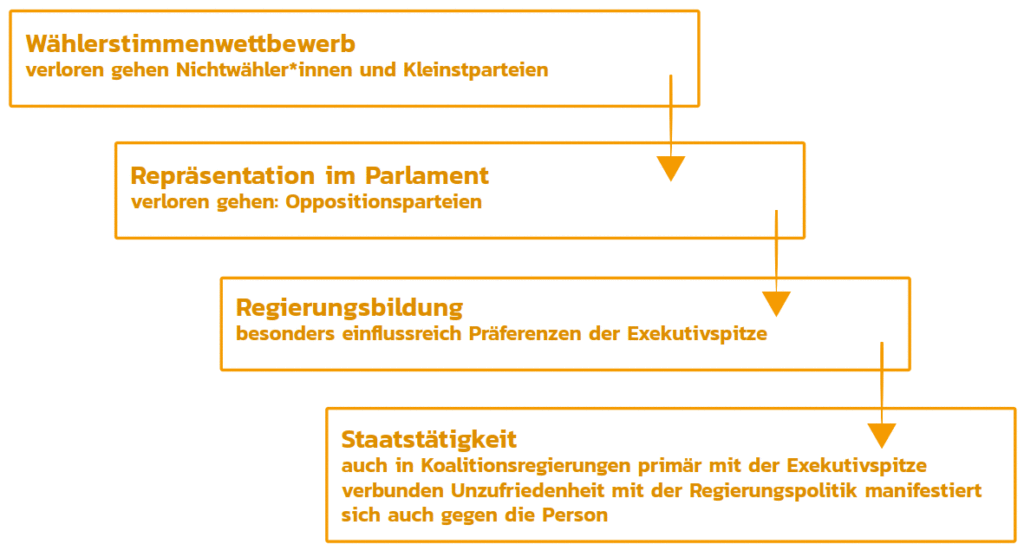
Abbildung 1: Die Delegations- und Responsivitätskette in parlamentarischen Demokratien (eigene Darstellung in Anlehnung an Powell 2019 und Strøm 2000)[21]
Hier kommt nun die Amtszeitbegrenzung ins Spiel: Sie ergibt dann Sinn, wenn sie der strukturellen wie temporalen Abnahme der Responsivität entgegenwirkt. Mit dem erzwungenen Austausch der Regierungsspitze wird zwar die Sanktionsmöglichkeit per Wahlen suspendiert – allerdings nicht für die Partei oder andere Regierungsmitglieder, sondern nur für die Spitze der Exekutive. Der Eingriff über eine Amtszeitbegrenzung wäre in einer parlamentarischen Demokratie also viel geringer als in einer präsidentiellen Demokratie, da die Sanktionsmöglichkeit der Regierungsparteien und somit der tragenden Säule der Exekutive bestehen bliebe! Er könnte aber die sich im politischen Prozess verfestigende Verkrustung der Verbindung zwischen Exekutivspitze, Fraktion und Parteiführung der größten Regierungspartei lösen. Die oben dargestellte Delegationskette würde dadurch potenziell stärker an die Partei und damit mittelbar – wenn auch bis zur nächsten Wahl nicht unmittelbar – an die Wählerschaft zurückgebunden. Die Hoffnung wäre also, eine höhere Responsivität darüber herzustellen, dass über neue personelle Ver- und Entflechtungen Gruppen in der Regierungsarbeit besser repräsentiert würden, die bislang nicht repräsentiert wurden. Eine neue Regierungsspitze sähe sich auch damit konfrontiert, eigene Leistungen gegenüber der Wählerschaft erbringen zu müssen, um für eine Mehrheit wählbar zu sein. Unter Umständen wäre sie auch darauf angewiesen, neue Wählergruppen ins Visier zu nehmen. Allerdings würde die neue Regierungsspitze ebenfalls den alten Regierungsparteien angehören – sofern mit dem Ausscheiden der alten Exekutivspitze nicht auch ein Wechsel der Koalitionspartner einhergeht. Einen echten demokratischen Wechsel kann eine Amtszeitbegrenzung selbstverständlich nicht ersetzen– ebenso wenig, wie die zahlreichen institutionellen Vetopunkte, wie z. B. die Möglichkeit der Anrufung des Verfassungsgerichts, einer strukturellen Minderheit gleiche Einflusschancen im politischen Prozess einräumt.[22] Wir müssen uns also abschließend fragen, ob die Amtszeitbegrenzung trotzdem zu einer Verbesserung der Demokratiequalität beitragen kann. Wäre sie geeignet, dem entgegenzuwirken, was die Politikwissenschaftler Schäfer und Zürn als »demokratische Regression« bezeichnet haben – nämlich der Abkehr vom Ideal der Demokratie bei gleichzeitigem Vertrauensverlust in die demokratischen Institutionen?[23]
Amtszeitbegrenzung als Prävention gegen unerwünschten Stillstand
Die Antwort ist: Das Fehlen einer Amtszeitbegrenzung erschwert eine Verbesserung der Repräsentationsbeziehung. Die obigen Überlegungen zeigen deutlich, dass umgekehrt die Existenz einer Amtszeitbegrenzung ein Gelegenheitsfenster zur Etablierung neuer Regierungs- und damit mittelbar auch Repräsentationsstrukturen öffnet – und damit auch die Chance böte, verlorenes Vertrauen in der Bevölkerung durch neues Spitzenpersonal aufzubauen. Dass neues Personal diese Chance nicht notwendigerweise auch nutzen würde, steht außer Frage. Zwei Entwicklungen der letzten Jahre in Verbindung mit unserem auf Stabilität ausgerichteten Grundgesetz lassen aber die Amtszeitbegrenzung umso notwendiger erscheinen: Erstens die zunehmende »Präsidentialisierung« der parlamentarischen Systeme und zweitens die Tendenz zu großen Mehrparteienkoalitionen. »Präsidentialisierung« heißt hier verkürzt, dass aufgrund zahlreicher parallel ablaufender Prozesse, wie der stärkeren Medienfokussierung und der komplexen Lösungsstrukturen der Institutionen der Europäischen Union mit seinen multiplen Entscheidungsebenen, die autonomen Handlungsbefugnisse der Exekutive so sehr zugenommen haben, dass in parlamentarischen Systemen die Exekutivspitze das Parlament, die eigene Partei und den Wahlprozess zunehmend dominiert.[24] Stärker als in der Vergangenheit gibt es also einen äußeren Druck, Ersatzkönig*innen zu schaffen. Diese nun mit zusätzlicher de-facto-Handlungsautonomie ausgestattete Exekutivspitze muss angesichts der zunehmend fragmentierten Parteienlandschaft mit der Tendenz, übergroße Koalitionen in der politischen Mitte zu schaffen, kaum noch befürchten, direkt abgewählt zu werden. Auch dies ist neu. Selbst wenn Helmut Kohl als erster Bundeskanzler mit seiner schwarz-gelben Regierung komplett abgewählt wurde, drohte doch über Jahrzehnte jeder anderen Bundesregierung bei Bundestagswahlen zumindest theoretisch ebenfalls die komplette Abwahl. Das ist in der Praxis aber nicht passiert – das heißt, die aktuelle politische Landschaft ist so beschaffen, dass die Sanktionsmöglichkeit der Wählerschaft gegenüber den Regierenden eingeschränkt ist. Dies ist exakt die Konstellation, vor welcher der Parteienforscher Giovanni Sartori immer gewarnt hat: Durch die Nicht-Möglichkeit, einen vollständigen Regierungswechsel herbeizuführen, werden die politischen Ränder gestärkt.[25] Die Unzufriedenen in der Wählerschaft haben gar keine andere Möglichkeit, als extremere Randparteien zu wählen, wollen sie die Regierung sanktionieren. So entsteht ein Teufelskreis: Da die Ränder stärker werden, müssen noch mehr Mitte-Parteien miteinander koalieren, weswegen extremere Randparteien gewählt werden, weswegen wieder nur die Parteien um die Mitte herum eine Koalition bilden können usw. Eine Amtszeitbegrenzung kann dieser Spirale der Stärkung extremer Parteien zumindest teilweise entgegenwirken. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Diskursqualität eines politischen Systems. Sie leidet aufgrund der (über)großen Koalitionen in der Mitte, weil die miteinander koalierenden Parteien weniger miteinander öffentlich streiten. Opponiert eine große mitte-rechts Partei oder ein Block aus mitte-rechts Parteien gegen ein mitte-links Regierungsbündnis, so kann die Wählerschaft deren Unterschiede klarer erkennen und deren Politik entsprechend sanktionieren oder belohnen. Öffentlich werden Alternativen aus der Mitte und nicht der extremen Ränder diskutiert.[26] Der oben diskutierte Begriff der »Alternativlosigkeit« verliert dann seine Bedrohlichkeit – weil die Alternativen klarer zu erkennen sind. Eine Amtszeitbegrenzung wäre vor diesem Hintergrund als eine Art Notfallmechanismus zu verstehen, der (mit-)verhindern soll, dass ein politisches System zu stark in eingefahrenen Bahnen verharrt. Der erzwungene Austausch der Exekutivspitze wäre somit als möglicher Impuls für eine Re-Konfiguration der politischen Landschaft zu sehen. Als solcher sollte er vorsichtig eingesetzt werden – weil die amtierende Regierungsspitze sich ja auf eine demokratisch legitimierte Mehrheit stützen kann.
Der doppelte Verweis der Gegner der Amtszeitbegrenzung zum einen auf andere parlamentarische Systeme, die auch keine Amtszeitbegrenzung hätten, sowie zum anderen auf die US-Präsidenten, die durch die Amtszeitbegrenzung zur »lame duck« würden, sticht meines Erachtens nicht.[27] Anders als in präsidentiellen Systemen bleibt die parlamentarische Regierung vom Vertrauen des Parlamentes permanent abhängig. Die beteiligten Regierungsparteien stehen zudem zur Wiederwahl. Eine tatsächlich machtlose Exekutivspitze kann sofort abgewählt werden. Es wäre schlicht eine ganz andere, mit einem präsidentiellen System nicht vergleichbare Situation. Die phasenweise Dominanz, mit der Angela Merkel während der Corona-Pandemie bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) auftrat, widerlegt aktuell das »lame duck«-Argument deutlich. Kritiker*innen, die von ihr in diesem Rahmen noch mehr Durchsetzungsfähigkeit erwarten, übersehen, dass der Bundeskanzlerin bei der MPK eigentlich so gut wie gar kein Einfluss zugedacht ist. Die Diskussion um ihre Rolle belegt also eher Merkels mittlerweile ungewöhnlich starke Stellung im politischen System der BRD, obwohl sie nicht zur Wiederwahl antritt. Bleibt der berechtigte Blick auf die anderen parlamentarischen Systeme. Diese sind aber weder institutionell noch politisch kulturell so stark auf Stabilität ausgerichtet wie das deutsche. Ein Beispiel hierfür ist das schwedische System.[28] Die dortige Lösung für eingefahrene Situationen besteht häufig in der Bildung einer Minderheitsregierung, weil hier alleine die Duldung einer Regierung ausreicht – ein Weg, der in Deutschland aufgrund des Erfordernisses einer »Kanzlermehrheit«[29] institutionell schwieriger umsetzbar und zudem bislang politisch-kulturell wenig populär ist. Das konstruktive Misstrauensvotum, das tatsächlich als deutsche Besonderheit für Stabilität im parlamentarischen System sorgt, ist diesen anderen Systemen fremd. Insofern wäre die Amtszeitbegrenzung als Mittel zur Prävention politischen Stillstandes als eine verfassungsrechtliche Ergänzung des für Stabilität sorgenden konstruktiven Misstrauensvotums zu sehen.
Fazit
Insbesondere bei dem so auf Stabilität bedachten System der BRD ergibt eine Amtszeitbegrenzung der Exekutivspitze Sinn, da so die Responsivität erhöht, die Repräsentationsbeziehung zur Bevölkerung verbessert und schließlich eine eingefahrene Regierungsbildungspraxis durchbrochen werden kann, die im ungünstigsten Fall eine Unzufriedenheitsspirale zugunsten der politischen Ränder auszulösen vermag. Allerdings sollte sie aufgrund ihres der Demokratie auf den ersten Blick wesensfremden Charakters als Teil der temporalen Gewaltenteilung mit Vorsicht eingeführt werden. Wer eine Amtszeitbegrenzung als sinnvoll erachtet, muss sich dazu äußern, wie lange denn die Amtszeit maximal dauern darf. Die häufig diskutierte Möglichkeit einer einmaligen Wiederwahl oder eine Begrenzung auf zehn Jahre orientiert sich an präsidentiellen Systemen. Für eine parlamentarische Demokratie halte ich diese Zeitspanne für zu kurz, da die Amtszeitbegrenzung nur als eine Art absolutes Limit zur Vorbeugung einer die Demokratie selbst unterminierenden Situation gedacht sein kann. So schnell entsteht ein*e Ersatzkönig*in vermutlich nicht – zumindest, soweit wir dies rückblickend erkennen können. Auch sollte bedacht werden, dass die oder der amtierende Kanzler*in eine demokratisch legitimierte Mehrheit hat. Entsprechend vorsichtig sollte das Instrument der Amtszeitbegrenzung eingesetzt werden. Sinnvoll ist sie zur Verhinderung einer eingefahrenen politischen Landschaft, in der es kaum die Aussicht auf einen vollkommenen Regierungswechsel gibt und die Parteien der Mitte als tatsächliche oder potenzielle Koalitionspartner sich öffentlich weniger voneinander klar abgrenzen, als wenn sie vollständig um die Regierungsmacht miteinander konkurrieren würden. Hier kann der erzwungene personelle Austausch ein Impuls für neue politische Bündnisse setzen und zur Revitalisierung des politischen Diskurses dienen.
Die Historie der BRD gibt zwei Anhaltspunkte für mögliche Zeitspannen: Der erste Kanzler Konrad Adenauer ging nach 14 Jahren, bei Helmut Kohl und Angela Merkel werden es jeweils 16 Jahre werden. Wenn wir diese Parallelität nicht als Zufall begreifen, sondern als Ausdruck des richtigen Zeitpunktes, dann sollten wir diese 16 Jahre als Referenz nehmen und als Notfallmechanismus im Grundgesetz verankern, um der im Zeitverlauf abnehmenden Responsivität – also einer verschlechterten Repräsentationsbeziehung – einer parlamentarischen Regierung institutionell entgegenzuwirken.
Literatur:
Dahl, Robert A.: Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven/London 1971.
Decker, Frank: Ist zwei Mal wirklich genug? Warum die For- derung nach einer Amtszeitbegrenzung der Bundeskanzler nicht zu Ende gedacht ist, in: Verfassungsblog, 02.06.2021, URL: https://verfassungsblog.de/ist-zwei-mal-wirklich-genug/ [eingesehen am 09.08.2021].
dpa: Grüne und CDU – Debatte um begrenzte Kanzlerschaft, in: zdf.de, 29.04.2021, URL: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/kanzler-zeit-begrenzung-merkel-baerbock-100.html [eingesehen am 09.08.2021].
dpa: Unwort des Jahres ist »alternativlos«, in: ZEIT ONLINE, 18.01.2011, URL: https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2011-01/unwort-2010-alternativlos [eingesehen am 09.08.2021].
Elsässer, Lea/Hense, Svenja/Schäfer, Armin: »Dem Deutschen Volke«? Die ungleiche Responsivität des Bundestags, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft, H. 27/2017, S. 161–180, URL: https://doi.org/10.1007/s41358-017-0097-9 [eingesehen am 20.08.2021].
Franzmann, Simon T.: Competition, contest, and cooperation: The analytic framework of the issue market, in: Journal of Theoretical Politics, Jg. 23 (2011), H.3, S. 317–343.
Franzmann, Simon T.: Die Wahlprogrammatik der AfD in vergleichender Perspektive, in: Mitteilungen des Instituts für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteien- forschung, H. 20/2014, S. 115–124.
Franzmann, Simon T.: Opposition und Staat. Zur Grundlegung der Parteiendemokratie, in: Bukow, Sebastian/Jun, Uwe/Niedermayer, Oskar (Hrsg.): Parteien in Staat und Gesellschaft.
Zum Verhältnis von Parteienstaat und Parteiendemokratie, Wiesbaden 2016, S. 51–83.
Ganghof, Steffen: Beyond Presidentialism and Parliamenta- rism. Democratic Design and the Separation of Powers, New York 2021.
Ganghof, Steffen: Politische Gleichheit und echte Mehrheits- demokratie: Über die normativen Grundlagen institutioneller Arrangements, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft, Jg. 15 (2005), H. 3, S. 741–763.
Golder, Matt/Ferland, Benjamin: Electoral rules and citizen-elite ideological congruence. The Oxford handbook of electoral systems, New York 2017.
Kaiser, André: Alternanz und Inklusion. Zur Repräsentation politischer Präferenzen in den westeuropäischen Demokratien, 1950–2000, in: Kaiser, André/Zittel, Thomas (Hrsg.): Demokratietheorie und Demokratieentwicklung, Wiesbaden 2004, S. 173–196.
Lijphart, Arend: Parliamentary versus presidential government, New York 1992.
Lijphart, Arend: Patterns of democracy, New Haven 2012.
Lowi, Theodore: Toward functionalism in political science: The case of innovation in party systems, in: American Political Science Review, Jg. 57 (1963), H.3, S. 570–583.
Poguntke, Thomas: Präsidentialisierung: Entmachtung des Parlaments?, in: Arnim, Hans-Herbert von (Hrsg.): Erosion von Demokratie und Rechtsstaat? Beiträge auf der 17. Speyerer Demokratietagung vom 26. bis 27. Oktober 2017 an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, Berlin 2018, S. 190–204.
Powell, G. Bingham: Representation, achieved and astray: Elections, institutions, and the breakdown of ideological con- gruence in parliamentary democracies, Cambridge 2019.
Prakash, Saikrishna Bangalore: The Living Presidency. An Originalist Argument Against Its Ever-Expanding Powers, Cambridge u.a. 2020.
Sartori, Giovani: Parties and Party Systems: a framework for analysis, Cambridge 1976.
Séville, Astrid: There is no alternative: Politik zwischen Demokratie und Sachzwang, Frankfurt a. M. 2017.
Séville, Astrid: Ton in Ton, in: taz, 30.10.2016, URL: https://taz.de/Astrid-Seville/!a36569/ [eingesehen am 09.08.2021].
Schäfer, Armin und Michael Zürn: Die demokratische Regression. Frankfurt am Main 2021.
Schmitt, Johannes/Franzmann Simon T: A Polarizing Dynamic by Center Cabinets? The Mechanism of Limited Contestation, in: Historical Social Research, Jg. 43 (2018), H. 1, S. 168–209.
Strøm, Kaare: Delegation and accountability in parliamentary democracies, in: European journal of political research, Jg. 37 (2000), H. 3, S. 261–290.
Tunk, Carola: Politikwissenschaftler Merkel: Amtszeit von Kanzlern unbedingt verkürzen, in: Berliner Zeitung, 26.03.2021, URL: https://www.berliner-zeitung.de/news/politikwissenschaftler-merkel-fordert-amtszeit-von-kanzlern-begrenzen-li.148755 [eingesehen am 09.08.2021].
[1]Zitiert nach: Tunk, Carola: Politikwissenschaftler Merkel: Amtszeit von Kanzlern unbedingt verkürzen, in: Berliner Zeitung, 26.03.2021, URL: https://www.berliner-zeitung.de/news/politikwissenschaftler-merkel-fordert-amtszeit-von-kanzlern-begrenzen-li.148755 [eingesehen am 09.08.2021].
[2]Vgl. etwa dpa: Grüne und CDU – Debatte um begrenz- te Kanzlerschaft, in: zdf.de, 29.04.2021, URL: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/kanzler-zeit-begrenzung-merkel-baerbock-100.html [eingesehen am 09.08.2021].
[3]Z. B.: Decker, Frank: Ist zwei Mal wirklich genug? Warum die Forderung nach einer Amtszeitbegrenzung der Bundeskanzler nicht zu Ende gedacht ist, in: Verfassungsblog, 02.06.2021, URL: https://verfassungsblog.de/ist-zwei-mal-wirklich-genug/ [eingesehen am 09.08.2021].
[4]Hier zitiert nach dpa: Unwort des Jahres ist »alternativlos«, in: ZEIT ONLINE, 18.01.2011, URL: https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2011-01/unwort-2010-alternativlos [eingesehen am 09.08.2021].
[5]Séville, Astrid: Ton in Ton, in: taz, 30.10.2016, URL: https://taz.de/Astrid-Seville/!a36569/ [eingesehen am 09.08.2021]. Detailliert in: Séville, Astrid: There is no alternative: Politik zwischen Demokratie und Sachzwang, Frankfurt a. M. 2017.
[6]Zur Gründung der AfD und zur Unterscheidung der Gründungsursache vom Gründungsanlass siehe Franzmann, Simon T.: Die Wahlprogrammatik der AfD in vergleichender Perspektive, in: Mitteilungen des Instituts für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung, H. 20/2014, S. 115–124.
[7]Politikwissenschaftlich präziser als »Präsidentialisierung« bezeichnet (vgl. Poguntke, Thomas: Präsidentialisierung: Entmachtung des Parlaments?, in: Arnim, Hans-Herbert von (Hrsg.): Erosion von Demokratie und Rechtsstaat? Beiträge auf der 17. Speyerer Demokratietagung vom 26. bis 27. Oktober 2017 an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, Berlin 2018, S. 190–204), worauf ich später noch eingehe.
[8]Da laut Dahl das Ideal der Demokratie nicht zu erreichen sei, sondern nur annähernd zu erfüllen, bezeichnete er die realen Ausprägungen als »Polyarchien«– Vielherrschaften, vgl. Dahl, Robert A.: Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven/London 1971
[9]Vgl. Lowi, Theodore: Toward functionalism in political science: The case of innovation in party systems, in: American Political Science Review, Jg. 57 (1963), H.3, S. 570–583 und Franzmann, Simon T.: Opposition und Staat. Zur Grundlegung der Parteiendemokratie, in:Bukow, Sebastian/Jun, Uwe/Niedermayer, Oskar (Hrsg.):Parteien in Staat und Gesellschaft. Zum Verhältnis von Parteienstaat und Parteiendemokratie, Wiesbaden 2016, S. 51–83.
[10]Ansonsten blieb bisher im Bund immer mindestens eine der vorherigen Regierungsparteien Teil der nachfolgenden Regierung.
[11]Prakash, Saikrishna Bangalore: The Living Presidency. An Originalist Argument Against Its Ever-Expanding Powers, Cambridge u. a. 2020, zitiert nach Ganghof, Steffen: Beyond Presidentialism and Parliamentarism. Democratic Design and the Separation of Powers, New York 2021, S. 7.
[12]Diese Informationen zur Genese der Schweizer Verfassung wurde entnommen aus Lijphart, Arend: Parliamentary versus presidential government, New York 1992. Zu den weiteren Besonderheiten der schweizerischen Exekutiv-Legislativ-Dynamik siehe Ganghof: Beyond Presidentialism, S. 35 ff.
[13]Vgl. Golder, Matt/Ferland, Benjamin: Electoral rules and citizen-elite ideological congruence. The Oxford hand- book of electoral systems, New York 2017.
[14]Vgl. Powell, G. Bingham: Representation, achieved and astray: Elections, institutions, and the breakdown of ideological congruence in parliamentary democracies, Cambridge 2019.
[15]Vgl. Franzmann, Simon T.: Competition, contest, and cooperation: The analytic framework of the issue market, in: Journal of Theoretical Politics, Jg. 23 (2011), H.3, S. 317–343.
[16]Elsässer, Lea/Hense, Svenja/Schäfer, Armin: »Dem Deutschen Volke«? Die ungleiche Responsivität des Bundestags, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft, H. 27/2017, S. 161–180, URL: https://doi.org/10.1007/s41358-017-0097-9 [eingesehen am 20.08.2021].
[17]Lijphart, Arend: Patterns of democracy, New Haven 2012.
[18]Powell: Representation, achieved and astray, S. 202.
[19]Vgl. Kaiser, André: Alternanz und Inklusion. Zur Repräsentation politischer Präferenzen in den westeuropäischen Demokratien, 1950–2000, in: Kaiser, André/ Zittel, Thomas (Hrsg.): Demokratietheorie und Demokratieentwicklung, Wiesbaden 2004, S. 173–196.
[20]Kaiser: Alternanz und Inklusion, S. 183.
[21]Vgl. Powell: Representation, achieved and astray und: Strøm, Kaare: Delegation and accountability in parliamentary democracies, in: European journal of political research, Jg. 37 (2000), H. 3, S. 261–290.
[22]Vgl. Ganghof, Steffen: Politische Gleichheit und echte Mehrheitsdemokratie: Über die normativen Grundlagen institutioneller Arrangements, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft, Jg. 15 (2005), H. 3, S. 741–763.
[23]Vgl. Schäfer, Armin und Michael Zürn: Die demokratische Regression. Frankfurt am Main 2021.
[24]Vgl. Poguntke: Präsidentialisierung.
[25]Sartori, Giovani: Parties and Party Systems: a framework for analysis, Cambridge 1976. Er spricht hier von einer zentrifugalen Wettbewerbsdynamik.
[26]Dies zeigt sich in einer Simulation schon alleine für die programmatischen Aspekte des deutschen Parteienwettbewerbs (Vgl. Schmitt, Johannes/Franzmann Simon T: A Polarizing Dynamic by Center Cabinets? The Mechanism of Limited Contestation, in: Historical Social Research, Jg. 43 (2018), H. 1, S. 168–209.). Die Diskursqualität und die Komponente der Personalisierung wurden dort (noch) nicht mit modelliert.
[27]Z. B.: Decker: Ist zwei Mal wirklich genug?
[28]Wieder kürzlich in Schweden im Juli 2021 zu beobachten, als der von der alten Koalition nicht mehr gestützte Ministerpräsident Löfven nach einer neuen geduldeten Regierung suchen konnte: O. A.: Löfven erhält eine neue Chance, in: tagesschau, 01.07.2021, URL: https://www.tagesschau.de/ausland/schweden-regierung-sondierung-loefven-101.html [eingesehen am 20.08.2021].
[29]Der umgangssprachliche Begriff »Kanzlermehrheit« existiert formal nicht. Er drückt aber hinreichend präzise aus, dass im deutschen System zur Wahl der Kanzlerin oder des Kanzlers in der Regel eine absolute Mehrheit der Parlamentsabgeordneten nötig ist. Eine Ausnahme bildet lediglich der noch nie eingetretene Fall, dass das Parlament innerhalb von 14 Tagen nicht eine solche Mehrheit findet, sodass in der dritten Wahlphase die einfache Mehrheit zur Wahl reicht.