Cancel Culture in digitalen ÖffentlichkeitenZum analytischen Potenzial eines politischen Kampfbegriffs
Eine Bedrohung der Meinungsfreiheit in liberalen Gesellschaften durch eine aufkommende Cancel Culture hält Teile der Presse in Atem: »Radikale Kräfte wollen an Universitäten eine neue Zensur durchsetzen.«[1] Nach dem Vorbild der US-amerikanischen Linken würden auch im deutschsprachigen Raum vermehrt bürgerliche und konservative Positionen angegriffen und ihre Vertreter:innen aus der Öffentlichkeit gedrängt. Was möglicherweise noch wie eine Sammlung von Einzelfällen wirke, sei tatsächlich Ausdruck einer linksradikalen Diskurshoheit, die abweichende Meinungen unterdrücke und damit erst am Anfang stünde – so suggeriert die Neue Zürcher Zeitung.
Der Literaturwissenschaftler Adrian Daub hat in der Edition Suhrkamp eine Analyse dieses Krisendiskurses vorgelegt. Er entlarvt ihn als moralische Panik mit historischen Kontinuitäten, die interessante Phänomene und Entwicklungen jedoch eher verschleiere als offenlege.[2] In seiner Analyse legt er einen Schwerpunkt auf den Universitätscampus als Ursprung vieler Anekdoten des Diskurses – wodurch die Dynamik des Cancelns in Sozialen Medien am Rande der Betrachtung bleibt.
Der vorliegende Beitrag vollzieht Daubs Analyse nach und versucht auf dieser Grundlage, auch Phänomene des Cancelns in digitalen Öffentlichkeiten analytisch greifbar zu machen – jenseits des politisierten Kampfbegriffs der Cancel Culture. Dafür stelle ich zunächst Daubs Dekonstruktion des Krisendiskurses vor und identifiziere deren Leerstelle in Bezug auf Soziale Medien. Anschließend entwickle ich ein soziologisches Konzept des Cancelns, das in der Lage ist, Cancel-Phänomene für eine Debatte jenseits politischer Kampfbegriffe zu erschließen. Damit möchte der Beitrag eine kritische Perspektive vorschlagen, die sich jedoch dezidiert nicht zu Warnungen vor dem Ende der liberalen Gesellschaft hinreißen lässt.
Die Dekonstruktion des Cancel-Culture-Diskurses
Daub widmet sich vor allem den deutschen, aber auch den angelsächsischen und französischen Debatten über die Grenzen des Sagbaren, Ansprüche an inklusive Sprache, diskriminierendes oder übergriffiges Verhalten am Arbeitsplatz und Proteste bei öffentlichen Auftritten – also den Debatten, die oft unter den Schlagworten politische Korrektheit, Cancel Culture und Wokeness geführt werden. Er stützt sich auf eine quantitative Erhebung von Begriffskonjunkturen im Zeitverlauf, Fallstudien zu bekannten Anekdoten und deren melodramatischer Überhöhung im Diskurs, deren literarische Verortung im Genre der Campus-Romane sowie auf Interviews mit Zeitungs-Redakteur:innen. Diese vielfältige empirische Grundlage führt Daub nicht streng strukturiert, aber doch überzeugend argumentiert zu einem Tableau der Debatte zusammen.
Die Krisendiagnose des Cancel-Culture-Diskurses lässt sich laut Daub wie folgt zusammenfassen: Was zunächst in Sozialen Medien als rhetorische Entgleisung, Aggression und Übertreibung in der kritischen Thematisierung von politischen wie sozialen Problemen begonnen habe, habe sich mittlerweile zu einem linken Radikalismus ausgewachsen, der weite Teile von Universitäten, Verlagen und sogar Unternehmen erfasst habe. Diese Milieus handelten vorgeblich im Namen der Emanzipation, verträten dabei jedoch einen totalitären Anspruch. Ihre Kritik ziele nicht auf eine konstruktive Debatte, sondern auf eine Bestrafung ab, sei gegen Personen statt Verhalten gerichtet und erstrecke sich ohne Differenzierung auch auf das Umfeld der Kritisierten. Der totalitäre Anspruch zeige sich im Ziel, missliebige Personen und deren Leistungen auch rückwirkend aus der Geschichte zu radieren – Angriffe »auf spezifische Personen, hinter denen ein breiterer Angriff auf die Prämissen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung lauert.«[3] Die Drohung solcher Angriffe führe zu einer ausufernden Selbstzensur und treibe letztlich eine Spaltung der Gesellschaft voran.
Eine moralische Panik …
Daub kann jedoch zeigen, dass der Diskurs über Cancel Culture eher Merkmale einer moralischen Panik als einer präzisen Gegenwartsdiagnose aufweist. Das entscheidende Merkmal einer moralischen Panik ist, dass sie sich nicht auf Vorfälle stützt, die der Fiktion entspringen, sondern dass sie tatsächliche Vorfälle fiktionalisiert: Anekdoten werden aus ihrem Kontext gerissen und als allgemeiner Trend bezeichnet. Dieser wird medial aufgegriffen, dramatisiert und als Bedrohung gesellschaftlicher Werte definiert. Eine solche Krisendiagnose liefert fortan eine stereotype Schablone zur Identifizierung weiterer Fälle und Probleme.[4] Daubs Kritik am Cancel-Culture-Diskurs ist demnach nicht, dass er der reinen Fantasie entspringe,[5] sondern dass er derart fiktionalisiert werde, dass seine politische Wirkmächtigkeit in keinem Verhältnis zur Ausgangslage stünde: Aus linkem Protest werde eine totalitäre Bedrohung der freien Gesellschaft konstruiert.
Diese Fiktionalisierung von Anekdoten durch eine Dekontextualisierung und Melodramatisierung kann mit Hilfe von Daubs literaturwissenschaftlichem Instrumentarium sehr präzise herausgearbeitet werden. Entlang mehrerer Fallstudien zeigt er auf, dass typische Beiträge des Cancel-Culture-Diskurses sich nicht der Analyse und Einordnung der kritisierten Vorfälle widmeten, sondern diese vielmehr verallgemeinert und als Bestätigung des bereits Bekannten herangezogen würden. Die Relevanz werde dabei vorausgesetzt – ungeachtet dessen, dass der Bezug zwischen einer scharf kritisierten Vorlesung an einem kleinen US-amerikanischen College oder einer Nischen-Debatte in Sozialen Medien und dem Stand der Meinungsfreiheit in Deutschland sehr wohl begründungspflichtig sei. Selbst schon länger zurückliegende Anekdoten würden regelmäßig angeführt, ohne die meist marginalen oder sogar ausbleibenden Konsequenzen für die Betroffenen entsprechend einzuordnen.
Beiträge, die sich der ausführlicheren Vorstellung eines Vorfalls widmen, fielen durch eine starke Melodramatisierung auf: In szenischen Einstiegen hetzt der professorale Protagonist als Ausgestoßener durch eine Menge tuschelnder Studierender. Ein Gespräch mit der Universitätsleitung wird semantisch in den Gerichtssaal verlegt: Der Angeklagte steht vor dem Tribunal und wartet darauf, sanktioniert zu werden. Als tragisch-ironische Pointe des Geschehens stellt sich heraus, dass der Beschuldigte doch eigentlich selbst linksliberal sei; wenn es ihn treffe, könne es wohl jeden treffen. Selbst die eindeutig literarische Version dieser Pointe – Philip Roths Roman »Der menschliche Makel« – wird als Beleg einer realen gesellschaftlichen Bedrohung herangezogen.
Das Ziel dieser Fiktionalisierungen sei die ständige Verknüpfung von »Gegenwart und Vergangenheit, Anekdote und System […], ohne diese wirklich jemals explizit […] untermauern«[6] zu müssen. Sie zeigten ihre Wirkmacht spätestens dann, wenn die Campus-Posse als Vorbotin der Kulturrevolution erst auf den zweiten Blick weit hergeholt erscheint – an derartigen Verknüpfungen zu totalitären Regimen und ähnlichen Eskalationen fehlt es im Diskurs nicht.
… mit historischen Kontinuitäten …
Daub arbeitet ebenfalls detailreich heraus, dass diese Fiktionalisierung von Anekdoten bereits seit über 30 Jahren die Debatte über politische Korrektheit charakterisiere. Das sprichwörtliche Gespenst des linken Totalitarismus stehe angeblich schon lange kurz vor seiner Materialisierung. Neben der Entlarvung als moralische Panik ist dies der zweite zentrale Befund von Daubs Analyse des Cancel-Culture-Diskurses: Er stünde – mit gewissen Akzentuierungen – in einer eindeutigen und überraschend stabilen historischen Kontinuität. »Der Ton, der Duktus […] ist erstaunlich monolithisch und darüber hinaus seit Jahrzehnten konstant.«[7] So zeichnet Daub die Obsession von Teilen der US-amerikanischen Öffentlichkeit mit ihren Universitäten von den 1950er Jahren bis zu einer breiten Rezeption des Diskurses über die Gefahren politischer Korrektheit im Universitätskontext in den 1980 bis 1990er Jahren nach. Dessen Kontinuität zum heutigen Cancel-Culture-Diskurs wird durch einleitende Zitate illustriert, die sich im Vergleich der 2020er mit den 1990er Jahren kaum unterscheiden.
Kontinuitäten findet Daub auch bei den beteiligten Akteuren – wobei deutlich wird, dass es sich bei der Cancel-Culture-Debatte nicht um einen diskursiven Unfall handelt, sondern hier ein strategisch lancierter politischer Kampfbegriff erfolgreich medial verfängt. Daub muss dafür nicht von Hinterzimmer-Verschwörungen raunen, sondern verbindet überzeugend Kurzportraits konservativer »Anekdotenlieferanten«[8] mit Aussagen von Zeitungs-Redakteur:innen und begründeten Vermutungen, welche Funktion der Cancel-Culture-Diskurs für die beteiligten Akteure erfüllt. Ausgangspunkt des Diskurses seien organisierte konservative Netzwerke in den USA, für die die Sammlung und Dokumentation von potenziell verwertbaren Anekdoten Teil der politischen Auseinandersetzung sei. Die Verbreitung dieser Anekdoten im deutschen Feuilleton gelinge insbesondere dann, wenn sie von zumindest nominell linken oder liberalen Personen aufgegriffen werde, die vor linken Twitter-Mobs warnen. Das sei laut Daub auch eine Reaktion des Feuilletons auf seinen teilweisen Verlust von kultureller Deutungsmacht an die Sozialen Medien – weshalb sich die deutsche Debatte vor allem in diesem Ressort und nicht etwa im Politik-Ressort abspiele. Für Zeitungsverlage wiederum sei die Debatte ein lohnendes Produkt – mit geringem Rechercheaufwand ließen sich Seitenzugriffe und Abonnements steigern.
Der Diskurs sei damit für die Beteiligten schlicht nützlich: Konservative politische Akteure könnten sich auf einen gemeinsamen Gegner verständigen, Verlage in ökonomisch schwierigen Zeiten Leser:innen binden. Autor:innen des Feuilletons könnten sich als »heterodoxe Denker«, die dem »Zeitgeist Stopp entgegenbrüll[en]« gerieren, «intellektueller als die Intellektuellen, intelligenter als die Intelligenz […] als Fürsprecher für jene, die von den Modeerscheinungen und Irrtümern des Zeitgeists vor den Kopf gestoßen sind«.[9] Das Publikum könne sich zuletzt in oppositioneller Pose den eigenen Befindlichkeiten widmen und nebenbei eine Reihe gesellschaftlicher Probleme als in der Verantwortung übergeschnappter Linker stehend wegerklären.
… die interessante Phänomene verschleiert.
Mit seiner Analyse bewegt sich Daub weitestgehend jenseits der gegenwärtigen Kritik[10] am Cancel-Culture-Diskurs, die mit ihrem Fokus auf dessen Scheinheiligkeiten und Projektionen in der politischen Auseinandersetzung verhaftet bleibt.[11] Gleichzeitig identifiziert er solche Scheinheiligkeiten und Projektionen regelmäßig als lohnenswerte Ausgangspunkte, um hinter den Cancel-Culture-Diskurs zu blicken und Phänomene des Cancelns zu verstehen. Was sind also die Phänomene, die der Cancel-Culture-Diskurs entgegen seines Versprechens eher verschleiert als freilegt? An welchen Stellen kann eine Analyse ansetzen, die über Daubs Diskurskritik hinausgeht?
Zunächst verstellt, so sein Befund, eine gegenwärtige Verfremdung des Konzepts der Cancel Culture den Blick auf dessen frühe kritische Diskussion in »tendenziell linken, tendenziell jungen, tendenziell afroamerikanischen Onlinediskursen«.[12] Hier ging es um die Frage, wie produktiv oder eben unproduktiv bis grenzüberschreitend öffentliche Kritik in Sozialen Medien ist und inwiefern es für marginalisierte Gruppen überhaupt Alternativen gebe, Kritik zu äußern. Der Cancel-Culture-Diskurs deute diese differenzierte Debatte innerhalb der Linken zu einer politischen Strategie der Linken um, anstatt die Diskussion fortzuführen. Durch diese Umdeutung ändere der Diskurs auch das Subjekt: In den fiktionalisierten Anekdoten würden die gecancelten Personen zu Protagonist:innen, die von einer diffusen Menge aus Studierenden oder von einem Twitter-Mob bedroht würden. Diese Wahl bestimme zum einen, um wessen Befindlichkeiten es ginge, und zum anderen, wer medial zu Wort kommen und eine Position vertreten dürfe. Produktiver wäre es stattdessen, alle beteiligten Personen einer solchen Auseinandersetzung zu berücksichtigen bzw. auch die Befindlichkeiten marginalisierter Gruppen zu thematisieren.
Die Gegenüberstellung eines grundsätzlich privilegierten, aber vereinzelten Opfers und eines ggf. gesellschaftlich marginalisierten, aber zahlenmäßig überlegenen Mobs nehme zudem die Beantwortung einer Machtfrage vorweg, die zunächst noch diskutiert werden müsse: Wo wird welche Art von Macht verortet und kritisiert, wo nicht? Der Cancel-Culture-Diskurs setze zudem mindestens implizit und regelmäßig auch explizit eine Machtverschiebung vom Staat zur Zivilgesellschaft voraus, wenn letztere als neue Zensurinstanz kritisiert werde. Wer jedoch der Zivilgesellschaft Zensur vorwerfen wolle, müsse den Staat künstlich schwach schreiben – und mache sich bewusst blind für die wichtige Differenzierung zwischen der Macht des Staates und der Macht der Zivilgesellschaft.
Gegen Ende seines Buches nähert sich Daub anhand des Beispiels junger Autor:innen dem Kern, den ein produktiver Cancel-Culture-Diskurs haben könnte, und arbeitet Rahmenbedingungen heraus, unter denen zivilgesellschaftlicher Protest tatsächlich zu kritikwürdigen individuellen Konsequenzen führen könne: Dies könne Personen in prekären Arbeitsfeldern ohne einen starken Rückhalt durch Arbeitgeber:innen passieren, die aus beruflichen Gründen gehalten sind, sich in Sozialen Medien zu exponieren, dort mit einer engagierten und vernetzten Community agieren und bei dieser in Ungnade fallen. Auch wenn man Daubs Einschätzung, ab wann Konsequenzen bedenklich sind, nicht zwangsläufig teilen muss: Sein Beispiel ist weit differenzierter und überzeugender als die fiktionalisierten Anekdoten des Diskurses. Wer überall Cancel Culture vermutet, findet sie anscheinend nicht, wenn sie tatsächlich auftritt.
Analytische Leerstelle: Cancel Culture in digitalen Öffentlichkeiten
Daubs Analyse fokussiert darauf, wie und für wen der Cancel-Culture-Diskurs funktioniert. Durch seine Betonung von Kontinuitäten zur Kritik an Political Correctness steht das genuin Neue nur am Rande seiner Betrachtung – seine Analyse spiegelt einen Diskurs, der seit 30 Jahren den bald sicher eintretenden Totalitarismus der Linken ankündigt und darüber analytisch blind wird. Gleichzeitig gibt Daubs Buch zwei Hinweise, wo und wie eine lohnenswerte und ggf. kritische Analyse des Cancelns ansetzen kann: Erstens empfehlen die Ursprünge des Begriffs in selbstkritischen Onlinediskursen und die identifizierten Rahmenbedingungen für das Entstehen einer Cancel Culture eine Beschäftigung mit Sozialen Medien. Zweitens legen der Interaktionscharakter des Cancelns und die zentrale Rolle von Macht eine Analyse aus soziologischer Perspektive nahe. Im Folgenden widme ich mich daher den digitalen (Gegen-)Öffentlichkeiten[13], die durch Soziale Medien hergestellt werden, und versuche ein soziologisches Konzept zu umreißen, das dort stattfindende Cancel-Phänomene für eine produktive Debatte jenseits des politischen Kampfbegriffs erfassen kann.
Ausgangspunkt dafür ist der historische Ursprung des Cancelns und des Calling-outs in digitalen afroamerikanischen Gegenöffentlichkeiten. Calling-out ist hier eine aktivistische Strategie, um auf Diskriminierungserfahrungen hinzuweisen, die systemischen Ursprung haben und sich an prominenten Fällen herauskristallisieren. Es kanalisiert Aufmerksamkeit auf eine Problemlage, erlaubt die Diskussion von geteilten Diskriminierungserfahrungen und eröffnet eine Diskussion über die Bewertung von und mögliche Reaktionen auf diese.[14] Das Canceln als einer möglichen Form der Reaktion besteht im gezielten Aufmerksamkeitsentzug gegenüber einer (berühmten) Person oder Marke, deren Werte, Handlungen oder Äußerungen als dieser Aufmerksamkeit unwürdig empfunden werden – das digitale Pendant zum Boykott.[15] Die Verankerung beider Strategien in den Diskursen marginalisierter Personen ist dabei entscheidend: Nur im Angesicht sonstiger Machtlosigkeit ist Aufmerksamkeitsentzug eine naheliegende Strategie.
Ein soziologisches Konzept des Cancelns: Normsetzung und -durchsetzung
Diese Strategien der Problematisierung und des Protests beinhalten immer auch implizite oder explizite Erwartungen an alternatives Verhalten und Äußerungen – sie formulieren eine soziale Norm.[16] Für eine analytische Betrachtung des Cancelns in digitalen Öffentlichkeiten empfiehlt es sich, zunächst Inhalt, Urheber und Adressat dieser Norm zu verstehen: Welche Erwartung wird formuliert? Wer formuliert diese Erwartung? An wen wird sie adressiert? Die bloße Formulierung einer solchen Verhaltenserwartung bedeutet nämlich zunächst weder, dass sie in weiten Teilen der Gesellschaft akzeptiert und erfüllt wird, noch, dass es Konsequenzen hätte, ihr nicht zu folgen. Sie ist zunächst einmal nur ein Appell, der beispielsweise den Verzicht auf diskriminierende Sprache, Äußerungen oder Handlungen fordert. Calling-out bedeutet aus dieser Perspektive, dass der Verstoß gegen eine solche Norm öffentlich thematisiert und kritisiert wird.[17] Die entscheidende Frage ist hier, was einen Normverstoß konstituiert und wie schwerwiegend dieser ist: Welches Verhalten wird kritisiert? Inwiefern weicht dieses Verhalten von der postulierten Erwartung ab? Spätestens an dieser Stelle wird die Analyse offen normativ und muss sich in der Debatte herausfordern lassen: Wie nachvollziehbar und gerechtfertigt fällt die Bewertung eines potenziellen Normverstoßes aus?
Die Anekdoten des Cancel-Culture-Diskurses überspringen diese beiden Schritte und beginnen mit – in der Regel drastischen – Schilderungen von Reaktionen auf Normverstöße. Der Kontrast zur Begriffsgeschichte des Cancelns, die den Entzug von Aufmerksamkeit als einzig verbleibende Strategie des politischen Protests marginalisierter Gruppen identifiziert, zeigt, wie verkürzt diese Betrachtungsweise ist. Grundsätzlich ist jedoch sowohl in der Formulierung einer Norm als auch in der Kritik ihrer Missachtung durchaus der Wille angelegt, dass sie auch befolgt wird – nur ist eine entsprechende Normdurchsetzung[18] bei weitem nicht so einförmig oder gar erfolgreich, wie der Cancel-Culture-Diskurs suggeriert.
Die Macht zur Normdurchsetzung
Der Wille zur Durchsetzung von Normen rückt zwei Aspekte in den Fokus: Zunächst ist das die bereits angerissene Differenzierung zwischen der Formulierung einer Norm als Appell an das Verhalten von Dritten einerseits und der tatsächlichen Befolgung und damit Geltung einer Norm andererseits. Der Cancel-Culture-Diskurs missachtet diese Differenzierung regelmäßig, leitet schon aus einem Appell einen angeblichen Zwang ab und ignoriert überdies, dass Normen auch aus Überzeugung akzeptiert und befolgt werden können.[19] Der zweite Aspekt ist die zentrale Rolle von Macht für die Auseinandersetzung um Normen als Verhaltenserwartungen.[20] Zwar ist die Formulierung von Normen und die Kritik an Normverstößen auch durchgehend von Machtverhältnissen geformt; nirgends tritt dies jedoch so deutlich zu Tage wie in der Frage, welche Normen tatsächlich – auch gegen potenziellen Widerstand – durchgesetzt werden. Hier stellen sich die kritischsten Fragen jeder Analyse von Normdurchsetzungen in digitalen Öffentlichkeiten: Wer möchte eine Norm durchsetzen? Mit welchen Mitteln soll sie durchgesetzt werden? Wie erfolgreich sind diese Versuche? Auch hier folgt nahtlos die explizit normative Einordnung: Wie angemessen sind die gewählten Strategien im Hinblick auf das kritisierte Verhalten und die kritisierte Person? Wird Kritik ihrem Gegenstand gerecht oder schießt sie über ihr Ziel hinaus? Wie konstruktiv und produktiv ist sie – und wo schlägt sie ggf. sogar ins straf- oder zivilrechtlich Relevante um?[21]
Eine solche sequentielle, soziologische Definition des Cancelns als Versuch der Normsetzung und Normdurchsetzung in digitalen Öffentlichkeiten ermöglicht es, das Phänomen sowohl umfassend zu verstehen als auch zu kritisieren. Anders als im Cancel-Culture-Diskurs kann Kritik differenzierter geäußert und genauer verortet werden. Die Definition ist sensibel dafür, welche Phänomene ausschließlich in den Rahmen zivilgesellschaftlicher Auseinandersetzungen fallen und inwiefern darüber hinaus der Staat oder Unternehmen als Akteure auftreten, was die Abgrenzung zu staatlicher Zensur oder prekären Arbeitsverhältnissen erlaubt. Zuletzt ist sie – trotz ihres Ursprungs in digitalen afroamerikanischen Gegenöffentlichkeiten – ideologisch zwischen den verschiedenen Konfliktparteien neutral und zur Analyse sämtlicher Normsetzungen geeignet.
Cancel Culture und die Fiktion der liberalen Gesellschaft
Dadurch kann eine soziologische Betrachtung abschließend auch eine aufrichtigere Definition von Cancel Culture liefern als der korrespondierende Diskurs es vermag, wenn man an diesem Begriff festhalten möchte: Als Cancel Culture können die Muster des zivilgesellschaftlichen Konflikts über die Setzung und Durchsetzung konkurrierender Verhaltenserwartungen in digitalen Öffentlichkeiten bezeichnet werden. Sie umfasst einerseits die Möglichkeit marginalisierter Gruppen, sich über Diskriminierungserfahrungen auszutauschen, korrespondierende Normen zu formulieren und diese direkt an privilegierte Personen zu adressieren. Cancel Culture umfasst andererseits jedoch auch die Abwehrreaktion derer, die sich in Ignoranz ihrer Privilegien bislang in einer Gesellschaft der Freien und Gleichen wähnten und Erwartungen an ihr Verhalten als Zumutung empfinden. Der Cancel-Culture-Diskurs entpuppt sich in dieser Lesart als aggressiver Verteidiger einer wohligen Fiktion – eine durchaus notwendige Kritik des Cancelns leistet er jedoch nicht.
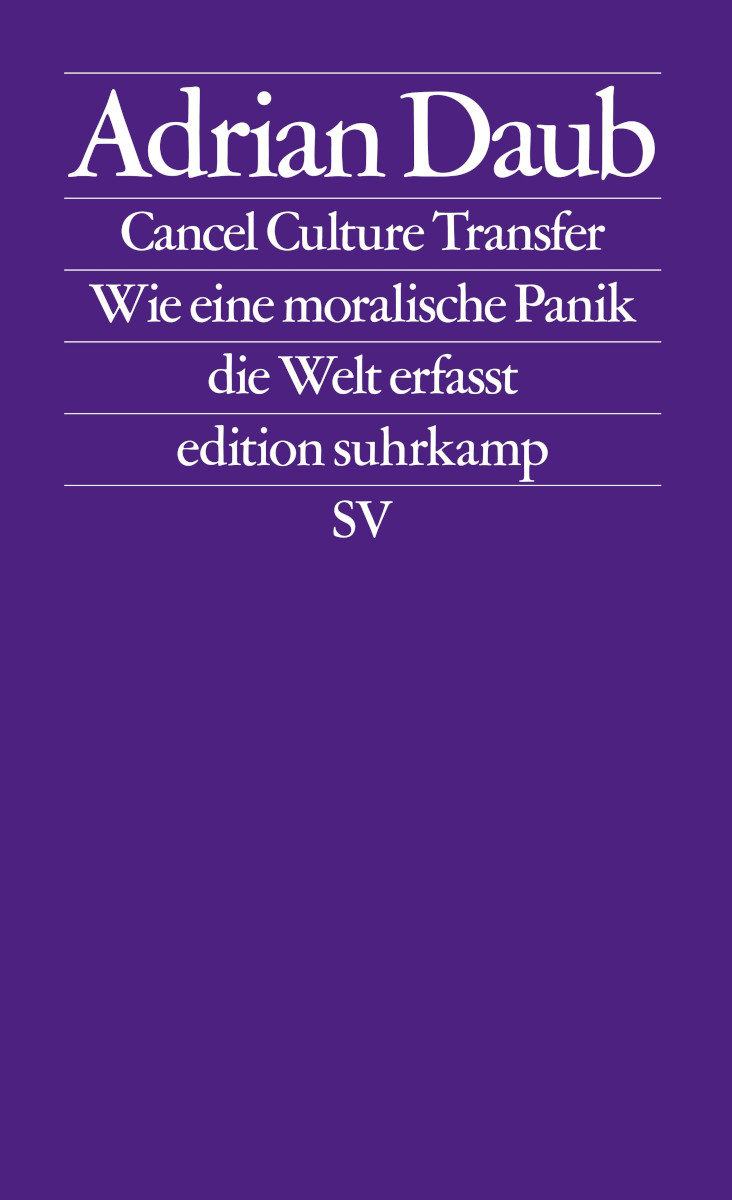
Adrian Daub: Cancel Culture Transfer. Wie eine moralische Panik die Welt erfasst, Berlin 2022. © Suhrkamp Verlag
Literatur::
Billingham, Paul/Parr, Tom: Online Public Shaming: Virtues and Vices, in: Journal of Social Philosophy, Jg. 51 (2020), H. 3, S. 371–390.
Clark, Meredith: Drag Them: A brief etymology of so-called «cancel culture”, in: Communication and the Public, Jg. 5 (2020), H. 3–4, S. 88–92.
Daub, Adrian: Cancel Culture Transfer. Wie eine moralische Panik die Welt erfasst, Berlin 2022.
Diez, Georg: Die Cancel-Culture-Strategie, in: Die Zeit, 14.11.2022, URL: https://www.zeit.de/kultur/2022-11/cancel-culture-meinungsfreiheit-politischer-diskurs-identitaetspolitik/ [eingesehen am 20.03.2023].
Gujer, Eric: Cancel Culture ist kein Studentenulk. Es ist eine neue Form des Extremismus, in: NZZ Online, 12.08.2022, URL: https://www.nzz.ch/meinung/cancel-culture-an-deruniversitaet-eine-neue-form-von-extremismus-ld.1697478 [eingesehen am 20.03.2023].
Knüpfer, Curd/Pfetsch, Barbara/Heft, Annett: Demokratischer Wandel, dissonante Öffentlichkeit und die Herausforderungen vernetzter Kommunikationsumgebungen, in: Oswald, Michael/Borucki, Isabel (Hrsg.): Demokratietheorie im Zeitalter der Frühdigitalisierung, Wiesbaden 2020, S. 83–101.
Schaible, Jonas: Warum wir den Begriff »Cancel Culture« canceln sollten, in: Der Spiegel, 30.08.2022, S. 50.
Schubert, Karsten: »Political Correctness« als Sklavenmoral? Zur politischen Theorie der Privilegienkritik, in: Leviathan, Jg. 48 (2020), H. 1, S. 29–51.
Thiele, Martina: Political Correctness und Cancel Culture – eine Frage der Macht, in: Journalistik – Zeitschrift für Journalismusforschung, Jg. 4 (2021), H. 1, S.72–79.
Villa, Paula-Irene/Traunmüller, Richard/Revers, Matthias: Lässt sich »Cancel Culture« empirisch belegen? Impulse für eine pluralistische Fachdebatte, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Jg. 71 (2021), H. 46, S. 26–33.
Wynn, Natalie: Canceling | ContraPoints, in: ContraPoints, 02.01.2020, URL: https://youtu.be/OjMPJVmXxV8 [eingesehen am 20.03.2023].
[1]Gujer, Eric: Cancel Culture ist kein Studentenulk. Es ist eine neue Form des Extremismus, in: NZZ Online, 12.08.2022, URL: https://www.nzz.ch/meinung/cancelculture-an-der-universitaet-eine-neue-form-vonextremismus-ld.1697478 [eingesehen am 20.03.2023].
[2]Vgl. Daub, Adrian: Cancel Culture Transfer. Wie eine moralische Panik die Welt erfasst, Berlin 2022.
[3]Daub, S. 41.
[4]Daub, S. 31–32.
[5]Damit unterscheidet sich Daub auch von Kritiker:innen des Cancel-Culture-Diskurses, die die Existenz sämtlicher korrespondierender Phänomene in Abrede stellen oder als durchgehend unproblematisch bezeichnen.
[6]Daub, S. 15.
[7]Daub, S. 14.
[8]Daub, S. 156.
[9]Daub, S. 24.
[10]Vgl. Diez, Georg: Die Cancel-Culture-Strategie, in:
Zeit Online, 14.11.2022, URL: https://www.zeit.de/kultur/2022-11/cancel-culture-meinungsfreiheit-politischer-diskurs-identitaetspolitik/ [eingesehen am 20.03.2023]. Vgl. ebenso Schaible, Jonas: Warum wir den Begriff »Cancel Culture« canceln sollten, in: Der Spiegel, 30.08.2022, S. 50.
[11]Daub möchte die Debatte versachlichen, auch wenn dies nicht immer gelingt: Die ein oder andere zusätzliche These wird eher als Spitze eingeworfen denn argumentativ untermauert – was sich kurzweilig liest, aber ähnlich wie der kritisierte Gegenstand die klare Analyse der Pointe opfert. Eine (kontrovers diskutierte) sozialwissenschaftliche Versachlichung durch die empirische Analyse von Selbstzensur an Universitäten streben bspw. Traunmüller und Revers an, vgl. Villa, Paula-Irene/Traunmüller, Richard/Revers, Matthias: Lässt sich »Cancel Culture« empirisch belegen? Impulse für eine pluralistische Fachdebatte, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Jg. 71 (2021), H. 46, S. 26–33.
[12]Daub, S. 85.
[13]Gegenöffentlichkeiten sind Kommunikationsräume marginalisierter Gruppen, die zur allgemeinen gesellschaftlichen Öffentlichkeit keinen Zugang haben oder sich bewusst jenseits dieser austauschen möchten. Solche Gegenöffentlichkeiten werden durch die Vernetzungsmöglichkeiten Sozialer Medien gestärkt bzw. teilweise überhaupt erst ermöglicht. Gleichzeitig verwischen Interaktionsmöglichkeiten in Sozialen Medien diese (analytische) Trennung, die heute eher mit dem Konzept von einzelnen Blasen innerhalb einer dissonanten Öffentlichkeit diskutiert wird. Vgl. Knüpfer, Curd/Pfetsch, Barbara/Heft, Annett: Demokratischer Wandel, dissonante Öffentlichkeit und die Herausforderungen vernetzter Kommunikationsumgebungen, in: Oswald, Michael/Borucki, Isabel (Hrsg.): Demokratietheorie im Zeitalter der Frühdigitalisierung, Wiesbaden 2020, S. 83–101.
[14]Vgl. Clark, Meredith: Drag Them: A brief etymology of so-called «cancel culture”, in: Communication and the Public, Jg. 5 (2020), H. 3–4, S. 88–92.
[15]Clark, S. 88.
[16]Vgl. Schubert, Karsten: »Political Correctness« als Sklavenmoral? Zur politischen Theorie der Privilegienkritik,in: Leviathan, Jg. 48 (2020), H. 1, S. 29–51.
[17]Vgl. Billingham, Paul/Parr, Tom: Online Public Shaming: Virtues and Vices, in: Journal of Social Philosophy, Jg. 51 (2020), H. 3, S. 371–390.
[18]Ich verwende hier bewusst nicht den auch soziologisch gebräuchlichen Begriff der Sanktion, um die Differenzierung zwischen staatlicher Sanktion und sozialer Sanktion deutlich zu machen.
[19]Vgl. dazu auch die hier ausgesparte, aber eng verwandte Kritik an Wokeness und Moralisierung in der öffentlichen Debatte. Beide Phänomene zeichnen sich dadurch aus, dass sie progressive Maßstäbe des Guten und Richtigen statt konservativer Maßstäbe des Guten und Richtigen anlegen – wodurch sie nicht zwangsläufig überzeugender, aber eben auch nicht zwangsläufig ideologischer sind. Auch unter diesen Schlagworten werden bloße Appelle als angebliche Übergriffe abgewehrt.
[20]Vgl. Thiele, Martina: Political Correctness und Cancel Culture – eine Frage der Macht, in: Journalistik – Zeitschrift für Journalismusforschung, Jg .4 (2021), H. 1, S. 72–79.
[21]Vgl. Wynn, Natalie: Canceling | ContraPoints, in: ContraPoints, 02.01.2020, URL: https://youtu.be/OjMPJVmXxV8 [eingesehen am 20.03.2023].